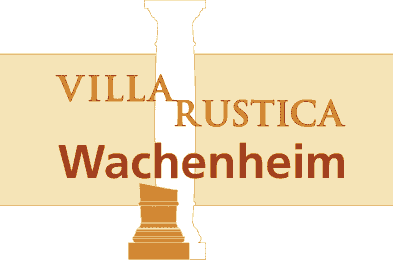Kulturdenkmal Villa rustica Wachenheim

Selbsterklärende Tafeln
Die 2023 angebrachten Tafeln enthalten wissenschaftlich fundierte Texte und Zeichnungen. Ihre Inhalte sind auf dieser Webseite im Menü Hintergrundwissen gegliedert und können jederzeit nachgelesen werden.
"Wer gräbt, der findet!" - unter diesem Motto steht die Entdeckungsgeschichte der Wachenheimer Villa rustica. Während der Flurbereinigungmaßnahmen im Jahr 1980 kamen unerwartet die Reste des römischen Gutshofs zutage. Die fast vollständige Villa rustica mit ihren spektakulären Funden ist heute als Kulturdenkmal von großem Wert, gibt sie uns doch Aufschluss über das Leben und Arbeiten der Römer in Wachenheim. Es folgten fast 10 Jahre, in denen die Archäologen beinahe das gesamte Hofgelände ausgraben konnten. Mit der Restaurierung der freigelegten Mauerzüge blieb dieses herausragende Zeugnis römerzeitlicher Siedlungsgeschichte der Nachwelt erhalten.
Die Bedeutung der Wachenheimer Römervilla liegt nicht nur in der stattlichen Größe der Anlage selbst, sondern vor allem in ihrer weitgehenden Vollständigkeit. Neben dem großen Herrenhaus sind nahezu alle Wirtschaftsbauten erkennbar. Die zahlreichen freigelegten Details fügen sich zu einem Gesamtbild ländlicher Besiedlung mit allen Aspekten landwirtschaftlicher Produktion.
Der Erhalt dieses einzigartigen Kulturdenkmals ist neben Fördergeldern und Spenden vom Verkauf unserer sehr umfangreichen und bebilderten Broschüre abhängig.
Römisches Leben vor 2000 Jahren
Die Villa rustica Wachenheim ist das erste in der Pfalz entdeckte römische Landgut in derart aufwendiger Steinbauweise, wie sie heute noch erkennbar ist.
Die archäologischen Grabungen ergaben, dass seine Anfänge auf das Jahr 20 n. Chr. zurückgehen. Der steinerne Ausbau erfolgte im 3. Jahrhundert. Anfang des 5.Jahrhunderts wurden die Gebäude durch einen Brand teilweise zerstört, ihre Reste dennoch bis weit ins 6. Jahrhundert weiter genutzt.
Besondere Merkmale des Freilichtmuseums sind:
- ein sehr weiträumiges, teilweise doppelstöckig gebautes Herrenhaus mit repräsentativer Empfangshalle, Wohnfläche etwa 2150 m²
- zwei großzügig angelegte Badeanlagen, jeweils für Herrschaft und Gesinde. Beide mit einer Hypokaustanlage, der römischen Fußbodenheizung, gebaut
- fast vollständig erhaltener Keller mithraeum mit Nischen
- zwei Grabmale direkt auf dem Gutsgelände, teilweise erhalten
- Sarkophage und Steinkisten vom südlich des Guts gelegenen Gräberfeld

Der säulengetragene Schutzbau über dem Keller wurde notwendig, da Starkregen auf Dauer das Fundament zerstört hätten. Vom Land Rheinland-Pfalz und der Stadt Wachenheim kamen Zuschüsse in eine Gesamthöhe von 55.000€, ein Teil wurde vom Förderkreis selbst aufgebracht und durch eigene aktive Arbeiten eingespart. Planung und Bauleitung blieben dank großzügigem Entgegenkommen der Architektur- und Ingenieurbüros kostenfrei.

Keller als Vorratsräume fanden sich in vielen römischen Bauten, jedoch nie über die gesamte Fläche sondern nur als kleiner, unterirdischer Raum. Der Keller der Wachenheimer Villa rustica hebt sich angesichts seiner Größe und qualitätsvollen Bauweise von vergleichbaren Bauten ab und gehört zu den größten bekannten Kellern entlang des Rheins.
Fundstücke

Eine steinerne Aschenkiste enthielt den berühmten Henkelkrug und eine Münze aus dem 2.Jhd. Zusammen mit Bruchstücken von Grabdenkmälern gaben diese beiden Fundstücke einen Hinweis auf den zur Villa rustica zugehörigen Bestattungsplatz.
Diese Funde und weitere Relikte aus der römischen Zeit in der Pfalz zeigt das Historische Museum Speyer.
Unter der Leitung von Prof. Dr. Helmut Bernhard vom Landesamt für Archäologische Denkmalpflege Speyer wurde die Villa rustica Wachenheim mit ihren Nebengebäuden ausgegraben, gesichert und teilweise rekonstruiert.
Es entstand ein Freilichtmuseum von 15000 m² Fläche. Das zum römischen Gutshof gehörige Gräberfeld wurde 1997 an der Straße Wachenheim-Friedelsheim 500 m südlich des Landgutes entdeckt.
Der Pfälzer "Urschoppen"
Gefunden wurden Steinsarkophage, Steinkisten, Ziegelplattengräber, teilweise mit wertvollen Grabbeigaben, wie einen Militärgürtel, den Sturzbecher, auch "Wachenheimer Urschoppenglas" genannt, und einiges mehr.
Der "Urschoppen" fast exakt eine Menge von 500ml Flüssigkeit, dem heutigen Pfälzer Maß für einen Schoppen. Beachtenswert ist die Tatsache, dass der "Urschoppen" keinen Fuß zum Abstellen hatte, er blieb also fest in der Hand, bis er geleert wurde.
Diese Funde und weitere Relikte aus der römischen Zeit in der Pfalz zeigt das Historische Museum Speyer.

Römische Bildhauerkunst


Die Beisetzung in einem Steinsarg konnten sich wohl nur Gutsbesitzer leisten. Auf dem Gelände fand man Reste zweier Grabdenkmäler (siehe kleinere Fotos oben). Der gelbe Sandstein zeigt den geflügelten Gott Amor. Die Platte mit der Löwentatze lässt darauf schließen, dass der dargestellte Löwe wohl überlebensgroß gewesen sein muss. Beide Grabmalreste stammen aus dem 3.Jahrhundert, der Blütezeit der römischen Bildhauerkunst.
Hintergrundwissen zu Bestattungsfeldern und Grabmalkunst
Grundriss und Rekonstruktion


Die Geschichte der römischen Besiedlung begann 20 n. Chr. mit dem Bau des Gutshofes in Holzbauweise. Funde aus dieser Zeit weisen auf eine elbgermanische Bevölkerungsgruppe hin, die aus Böhmen oder dem Elb-Saale-Gebiet zugewandert war und mit den germanischen Nemetern* in Verbindung zu bringen ist, was uns historisch überliefert ist.
Der Ausbau des Landgutes mit Gebäuden aus Stein beginnt im frühen 2.Jhd.
Nach Umbauten, vor allem im Bereich des Herrenhauses, dürfte der heute rekonstruierte Baubestand in das frühe 4.Jhd. gehören. Anders als viele römische Höfe in der Rheinebene hat die Villa rustica Wachenheim die Unruhezeiten des 3. und 4. Jhd. weitgehend unbeschadet überstanden.
Im 5.Jhd. bewohnte eine romanisch-germanische Bevölkerungsgruppe den weitgehend verfallenen Gutshof. Deren Bestattungsplatz lag an der nordöstlichen Ecke des Villenareals, im Bereich des Speicherbaus. Nach fast 480jähriger Besiedlungszeit wurden das Gelände und der Gutshof im 6.Jhd. entgültig verlassen. Unweit westlich davon, inmitten der Aue, ließen sich fränkische Siedler nieder und gründeten den bis ins 19. Jhd. bestehenden "Osthof".
* Die Nemeter waren ein germanischer Stamm im Gebiet des Rheins zwischen Pfalz und Bodensee.
Römischer Weinbau auf der Villa rustica

Reberziehungen wie in römischer Zeit wurde an der Haardt bis ins 19.Jahrhundert ausgeübt. Im Gegensatz zum Bockschnitt, wo die Rebe ohne Stütze auskommt, werden beim offenen Kammerrahmen niedrige Robinienpfähle mit Kastanienzweigen verbunden. Es entsteht ein Kammertwingert. Diese Form der Reberziehung ist durch den Einsatz von maschinell hergestelltem Draht leider verschwunden.
Die von den Wachenheimer Jungwinzern angebauten Reben der Sorte Phönix bringen Esstrauben hervor, die ohne jegliche Spritzmittel auskommen.
Hintergrundwissen zum Weinbau